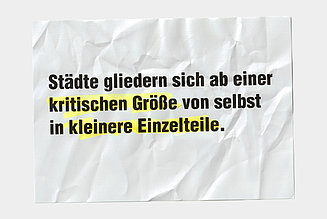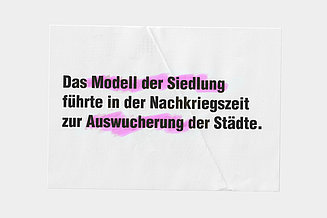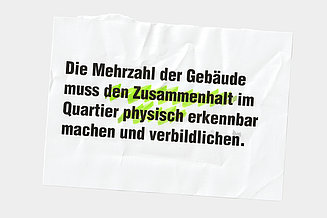Das Stadtquartier: Eine Annäherung
9 min LesezeitDabei sind die Hintergründe des Dilemmas bereits differenziert untersucht und überzeugend dargelegt worden. In seinem Werk „Gemeinschaft und Gesellschaft“ von 1887 unterscheidet der Soziologe Ferdinand Tönnies zwei Arten menschlichen Zusammenlebens: die althergebrachte, ursprüngliche Gemeinschaft, die er mit dem Haus, dem Dorf und der Kleinstadt in Verbindung bringt und deren Voraussetzung die Existenz eines Gemeinwesens ist, und die moderne Gesellschaft, in der jeder für sich allein ist und die in der Großstadt ihren ebenso kongenialen wie anonymen Ort hat.
Diesen Widerspruch hat die Stadtgemeinde, hat die Stadt weitgehend von selbst aufgelöst: Sie hat sich, sobald sie eine kritische Größe erreicht hat, in kleinere Einzelteile aufgegliedert. Vordergründig ging und geht es dabei um eine bessere, weil dezentrale und kontrollierbare, Verwaltung und Pflege der Stadt. In Tat und Wahrheit ist das eine Folge der Selbstorganisation der Bürger, die in ihrem Alltag vergleichsweise wenig Infrastrukturen brauchen – Kindergarten, Schule, Bäckerei, Lebensmittelgeschäfte, vielleicht ein Friseur, ein Café und ein Restaurant – und nur eine überschaubare Anzahl von Nachbarschaftsbeziehungen kontinuierlich pflegen können und wollen. Diese Einzelteile sind die Quartiere der Stadt.
Quartiere und Siedlungen
Was ist das eigentlich, ein Stadtquartier? Es hat eine doppelte Dimension: Es ist ein physischer Bereich einer Stadt und zugleich eine gesellschaftliche Entität. Im urbanen Sozialgefüge stellt es das Feld dar, in dem Kommunikation, Austausch, Bekanntschaft, Nachbarschaft, vielleicht sogar Freundschaft entstehen können; auf jeden Fall eine persönliche Verbundenheit, die zur gegenseitigen Verantwortung und zu sozialem, durchaus auch zu politischem Engagement führt. Architektonisch ist es jene überschaubare Gruppe von Häusern, Höfen, Straßen, auch von Plätzen und Parkanlagen, die sich in der Stadt strukturell abzeichnet, einen eigenen Charakter besitzt und wo sich eine solche zwischenmenschliche Verbundenheit herausbilden kann, ja deren Herausbilden sogar gefördert wird.
Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war es weitestgehend selbstverständlich, neue Stadtgründungen und Stadterweiterungen in Quartiere zu gliedern. Oft behielten die Dörfer, die eingemeindet wurden, ihren Namen und ihre Eigenschaften. In London gaben die Eigentumsgrenzen der privat entwickelten Estates die Struktur vor; in Berlin schlüsselte James Hobrecht seinen Erweiterungsplan in Teilbereiche auf, die er jeweils mit einem Platz und einer Kirche versah; sogar Ildefonso Cerda, der die Plangrundlage für die Entwicklung von Barcelona als homologe, unhierarchische Stadt für eine unhierarchische Gesellschaft schuf, strukturierte seine völlig gleichmäßige Blockstruktur durch Kindergärten, Schulen und Krankenhäuser zu einer funktionalen Komposition kleinteiliger Stadtelemente.
Das änderte sich in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts abrupt. Das Bebauungsmodell der Siedlung, das nicht vom Straßen- und Platzraum ausging, sondern von der einzelnen, möglichst günstig orientierten Wohnung, löste das des Quartiers ab. Funktional ging es ausschließlich um Wohnen, das von dem anderweitig untergebrachten Arbeiten getrennt und nur durch die unmittelbar notwendigen Wohnfolgeeinrichtungen ergänzt wurde; typologisch um Komplexe, die idealerweise im Grünen lagen und an die historische Stadt, die polemisch abzulösen sie sich anschickten, nur widerwillig anknüpften.
Das Modell der Siedlung erfreute sich einer atemberaubenden Fortune und einer entsprechenden Verbreitung. Zusammen mit dem Konzept der Gartenstadt führte es in der Nachkriegszeit zur Auswucherung der Städte, zu einem unverhältnismäßigen Landschaftsverbrauch, zu aufwendigen Mobilitätsbauwerken und zur weitgehenden Zerstörung des räumlichen und sozialen Zusammenhalts der Stadt.
Zum erklärt antistädtischen Siedlungsbau wurden nur vereinzelt Alternativformeln entwickelt. In Amsterdam erprobte Hendrik Petrus Berlage das Konzept des Dorfes in der Stadt, einer Art Mikroquartier, das mitten in der Großstadt eine Gemeinschaft behausen und Geborgenheit vermitteln sollte. Im Italien der 20er- und 30er-Jahre experimentierten Gustavo Giovannoni und Innocenzo Sabbatini mit urbanen Varianten der Gartenstadt, am erfolgreichsten im römischen Quartier Garbatella. In der Nachkriegszeit entstanden im Rahmen des Wiederaufbauprogramms der INA Casa dei quartieri autosufficienti: Aus den Siedlungen des Neuen Bauens abgeleitet, reicherten sie diese mit programmatischer Typenvielfalt, zusätzlichen Infrastrukturen und gemeinschaftlichen Freiräumen an. Ein zentrales Anliegen war die emotionale Aneignung durch die Bewohner, und dafür wurde die Architektur unverblümt traditionalistisch und geradezu malerisch: Ihre Vielfalt, Wiedererkennbarkeit und Maßstäblichkeit sollten die Identifikation fördern.
Jede Stadt schafft bei denen, die längere Zeit darin leben, ein Gefühl von Zugehörigkeit. Sie wird als etwas Eigenes angenommen, und es entsteht eine gemeinsame Identität. Dazu tragen die großen Monumente bei, aber auch die Häuser, die den Monumenten als Hintergrund dienen, und die Details, die den Stadtraum bestimmen und unverwechselbar machen: von den Stadtbänken bis zur Straßenpflasterung.
Am intensivsten stellt sich Identität allerdings im urbanen Quartier ein. Die große Stadt als Ganzes, das ist eine Projektion. Das Quartier, das ist die Realität. Im Quartier verbringt man sein Alltagsleben, pflegt seine unmittelbaren Beziehungen, erlebt den Alltag mit seinen Ereignissen, seinen Ärgernissen und seinen Freuden. Und setzt sie mit den Bauten und den Räumen in Beziehung, in denen sie sich abspielen. Das Stück Stadt wird auch dann, wenn man nicht dort geboren ist, zu einem Stück Heimat.
Annäherung an ein idealtypisches Stadtquartier
Was macht, stadtarchitektonisch betrachtet, ein modellhaftes Quartier aus? Zunächst: ein ausgewogener Nutzungszusammenhang, verbunden mit einer angemessenen Größe. Überwiegend wird es um Wohnhäuser gehen. Dazu kommen Kindertagesstätten, Kindergärten, Schulen, aber auch Läden für den täglichen Bedarf. Und durchaus auch Arbeitsorte: Büros, Manufakturen, möglicherweise auch kleine Fabriken. Ein Quartier ist keine Schlafsiedlung und auch kein Arbeitsgetto. Ein Quartier ist idealerweise eine kleine Stadt in der großen.
Mit seinem Straßensystem wird sich das Quartier vernetzen; gleichwohl benötigt es einen besonderen, klar erkennbaren Plan. Er muss an bestehende Strukturen anbinden, aber eine eigene Gestalt aufweisen und neben Anschlusspunkten auch Grenzen: nicht physische, sondern ästhetische. Die Geometrie des Straßenmusters muss in sich konsistent sein: ganz gleich, ob orthogonal oder gekurvt, ob hierarchisch oder homolog. Sie macht das Stadtviertel zu einem architektonischen Wurf und trägt zu seiner Unverwechselbarkeit bei.
Allerdings kaum alleine. Innerhalb des Straßenmusters müssen die Architekturen miteinander verwandt sein. Die mindeste Verwandtschaft ist die des Typus, die maximale die der Architektursprache, die sich in den Fassaden ausdrückt. Freilich müssen und werden nicht alle Häuser aus einer Familie stammen: Zu einem Quartier mit Nutzungsmischung gehören auch Bauten, die Ausnahmen bilden – in allererster Linie die gemeinschaftlichen Bauten. Doch die Mehrzahl der Gebäude muss den Zusammenhalt im Quartier physisch erkennbar machen und verbildlichen.
Unbedingt braucht ein Quartier ein gemeinschaftliches Zentrum: einen Platz. Auch ein Anger oder ein Park, selbst eine besondere Straße vermögen diese Aufgabe zu erfüllen. Dieses Zentrum, es können auch mehrere Zentren sein, hat funktionale Gründe: Veranstaltungen wie ein Wochenmarkt oder Feste benötigen einen geeigneten Raum. Es hat aber auch symbolische Gründe: Die kleine Gemeinschaft braucht einen Ort, wo sie zusammenkommen, sich darstellen, sie selbst sein kann.
Die öffentlichen Räume, die Straßen und Plätze, müssen in einem Stadtquartier konsistent gestaltet sein. Nicht notwendigerweise einheitlich: Abstufungen, Hierarchien, ja selbst Kontraste sind denkbar. Aber solcherlei Deklinationen müssen durch ein Repertoire und ein Regelsystem zusammengehalten werden. Sie betreffen die Bodenbeläge, die Bürgersteige, die Vorgärten, die Einfriedungen, aber auch die Straßenbeleuchtung, die Sitzbänke und letztlich sämtliche Möblierungselemente des Stadtraums. Diese kleinen Dinge müssen den urbanen Raum nicht nur benutzbar und einladend machen, sondern auch charakteristisch.
All dies, Bauten und Freiräume, muss dauerhaft sein. Identifikation und Heimatgefühle stellen sich nur in einem beständigen Umfeld ein: sozial beständig und physisch beständig, über Jahrzehnte, ja Jahrhunderte hinweg. In einer sich unablässig verändernden Umgebung wird keine Nachbarschaft zustande kommen, keine Vertrautheit und auch keine Identität. Ein Quartier aus Kurzbewohnern und Wegwerfhäusern wird nie zu einer Gemeinschaft und zu einem Stück Stadt – und damit auch nicht zu einem richtigen Quartier.
Doch genau darum geht es bei der architektonischen Arbeit an der Stadt: um richtige Quartiere. So vielgestaltig, schillernd und schwer fassbar es auch ist: Das Viertel ist ein grundsätzlicher Baustein der Stadt. Wenn wir heute keinen beliebigen Siedlungsbau, sondern kraftvollen Stadtbau betreiben wollen, dürfen wir nicht Areale, Wohnanlagen, Überbauungen realisieren. Wir müssen, wie wir sie auch immer deuten wollen, Quartiere bauen.
Über den Autor
Prof. Dr. Vittorio Magnago Lampugnani,
1951 in Rom geboren, studierte dort an der Universität La Sapienza und an der Universität Stuttgart Architektur. In den 80er-Jahren gestaltete er die Internationale Bauaus-
stellung Berlin maßgeblich mit. Später gab er in Mailand die Zeitschrift Domus heraus und war Direktor des Deutschen Architektur-Museums in Frankfurt am Main. Von 1994 bis 2016 hatte er den Lehrstuhl für Geschichte des Städtebaus an der ETH in Zürich inne.
Seit 1981 führt er das Studio di Architettura in Mailand, seit 2010 mit einem Partner das Büro Baukontor Architekten in Zürich. Daneben lehrt er in Harvard und schreibt für die Neue Zürcher Zeitung.
Jetzt das HOMEBOOK bestellen
Sie sind Innenarchitekt*in oder Architekt*in? Dann bestellen Sie ganz exklusiv und kostenlos unser „Look and Feel“-Buch und lassen sich visuell, ideell und haptisch berühren.
Jetzt bestellen Zum Archiv