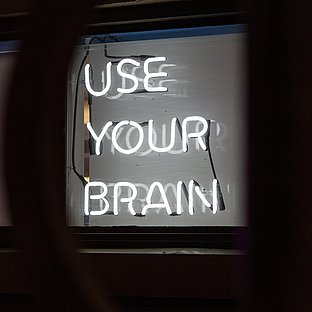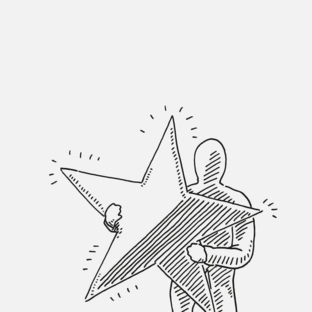Individualität: „… weil ich etwas ganz Besonderes bin!“
8 min LesezeitEine psychologische Betrachtung von Individualität
Das Wort Individuum kommt aus dem Lateinischen und bedeutet unteilbar. Wir sind also einzigartig, jeder Mensch ist anders, für sich genommen eine Einheit, ein unteilbares Ganzes. Doch hilft uns diese Definition weiter? Reicht es uns, zu wissen, dass wir einzigartig sind? Ist es nicht viel bedeutender, wie diese Einzigartigkeit im Detail aussieht, wie sie mit Leben gefüllt wird?
Wären Sie im alten Griechenland zum Orakel von Delphi gepilgert, um sich die Zukunft vorhersagen zu lassen oder um Rat zu fragen, hätten Sie über dem Eingang einen Satz lesen können: ‚Erkenne Dich selbst.‘ Genau das war auch das Motto dieser Prozedur. Die Antworten des Orakels sollten den Fragenden zum Nachdenken anregen und zu einem Selbst-Bewusstsein im wortwörtlichen Sinne führen. Ziel war es, die eigene Individualität zu erkennen. Das war zur damaligen Zeit nämlich nichts, worüber man sich normalerweise Gedanken machte. Heute sind wir die Architekten unseres Lebens. Wir machen unser Leben. In früheren Zeiten machte das Leben die Menschen. Das Leben war hart. Viele Krankheiten waren ein sicheres Todesurteil, eine längere Dürreperiode ebenso. In der längsten Zeit der Menschheitsgeschichte ging es nicht darum, sich und sein Leben immer wieder neu zu kreieren, sondern schlicht zu überleben.
Stellen Sie sich vor, Sie würden mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit reisen und dort Leute auf das Thema Selbstverwirklichung ansprechen. Niemand würde verstehen, was Sie meinen. Und dafür müssten Sie nicht bis in die Steinzeit oder Antike reisen. Selbst vor 30 Jahren war für viele Menschen dieser Begriff ein Fremdwort. Das Zeitalter der Globalisierung und Digitalisierung mit ihren scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten erlaubt eine stetige Weiterentwicklung und Neuerfindung. Das bedeutet eine enorme Freiheit, weil sich jeder von unliebsamen Strukturen lösen und ein selbstbestimmtes Leben nach eigenen Vorstellungen gestalten kann. Eng verbunden damit ist die Chance, ein Leben zu führen, mit dem man glücklich ist und das Sinn vermittelt. Die Kehrseite der Medaille können aber Stress und Frustration beim ewigen Suchen, Ausprobieren, Verwerfen und Neustart sein. So wird die Individualität zur Lebensaufgabe.
Diese Frage ist heute – mehr als 2000 Jahre nach den Pilgerfahrten zum Orakel von Delphi – vielleicht so aktuell wie noch nie. Von dem französischen Philosophen René Descartes stammt im 17. Jahrhundert der Ausspruch: „Ich denke, also bin ich.“ Ob wir tatsächlich sind, ist heute nicht mehr die große Frage. Niemand von uns zweifelt an seiner Existenz. Die Frage des Menschen im 21. Jahrhundert ist eher: „Was steckt alles in mir und wie entwickele ich mich weiter?“ Also: Wie bin und wie könnte ich morgen sein? Der Philosoph Richard David Precht brachte es vor einigen Jahren mit seinem Bestseller „Wer bin ich – und wenn ja, wie viele“ auf den Punkt.
Wer sind WIR also?
Wir waren ungefähr ein Jahr alt, als wir langsam anfingen zu verstehen, dass wir ein Individuum sind. In den ersten Lebensmonaten verschmolzen wir noch mit der Welt. Hatten wir Hunger, so übermannte uns dieses Gefühl. Es war so groß, dass die gesamte Welt um uns herum nur noch aus Hunger bestand. Alles war darauf ausgerichtet, den Hunger zu stillen. Nahrung wurde uns zugeführt und wir waren zufrieden. Und damit war auch die ganze Welt zufrieden. Die Unterscheidung zwischen ‚wir‘ und ‚die anderen‘ gab es damals für uns noch nicht. Mit der Zeit verstanden wir, dass wir Teil eines Netzwerks sind, dass Mama und Papa ebenfalls Individuen sind, die vielleicht ein Lächeln von uns mit einem Stück Schokolade beantworten. Oder auch, dass nur einer von beiden mit Schokolade reagiert. Wir lernten zu unterscheiden und wir verstanden, dass unsere Bedürfnisse nicht die Bedürfnisse der Welt sind. Das bedeutete aber auch einen enormen Schock. Wir verstanden nämlich, dass wir eigentlich allein sind, dass wir hilfsbedürftig und abhängig sind. Psychoanalytiker gehen davon aus, dass aber genau diese frühkindliche Erfahrung ein wichtiger Motor für unsere Entwicklung zu einem Individuum ist. In uns entstand der Drang, sich zu entwickeln, um mit den Anforderungen der Welt besser umgehen zu können.
Wir sind also ein Individuum
Als wir ungefähr zwei Jahre alt waren, schauten wir in den Spiegel und erkannten uns. Wir sahen, dass wir wir sind und das neben uns vielleicht die Mama, der Papa oder der Familienhund ist. Der sogenannte Spiegeltest, wie er in der Psychologie bezeichnet wird, zeigt, ob jemand ein Bewusstsein über sich hat. Üblicherweise wird dem Kind ein Punkt ins Gesicht gemalt. Wenn es in den Spiegel blickt und versucht, den Punkt am Gesicht und nicht am Spiegelbild wegzuwischen, hat es den Test bestanden. Es hat also eine Idee von sich selbst, eine Selbstwahrnehmung. Interessanterweise bestehen auch eine Reihe von Tieren diesen Test, zum Beispiel Affen, Elefanten und Elstern. Die Schlussfolgerung lautet, dass nicht nur wir Menschen über ein Bewusstsein verfügen, sondern auch Tiere sich als Individuum wahrnehmen können. Der Familienhund besteht den Test übrigens nicht. Allerdings darf das nicht direkt als fehlende Selbstwahrnehmung gedeutet werden. Hunde nehmen ihre Umwelt eher über den Geruch und weniger visuell wahr, weshalb der Test bei ihnen nicht fair ist.
In der Geschichte der Wissenschaft gab es immer wieder Erklärungsmuster dafür, wieso ein Mensch ist, wie er ist. Eine vorherrschende Rolle spielten dabei die Gene. Mit Genen wurde oft sogar versucht, den ganzen Menschen in seiner Komplexität zu erklären. Gene wären also dafür verantwortlich, dass eine Person zum Lügen neigt oder ein besonders großes Selbstbewusstsein hat. Die entgegengesetzte Erklärung lieferte der Behaviorismus, der seine Blütezeit in den 50er-Jahren des vorigen Jahrhunderts erlebte. Man ging davon aus, dass unser Verhalten ein Ergebnis der Erziehung und damit erlernt ist. John B. Watson, einer der wichtigsten Vertreter dieser psychologischen Strömung, soll gesagt haben: „Gebt mir ein Dutzend gesunder Kinder und ich mache aus ihnen, was ich will.“ Heutzutage wird davon ausgegangen, dass genetische Anlagen und die Einflüsse aus der Umgebung gleichermaßen einen Einfluss darauf haben, wie ein Mensch ist. Grundlage für diese Sichtweise sind unter anderem Studien mit eineiigen Zwillingskindern, die gemeinsam oder getrennt voneinander aufwuchsen.
Das bedeutet, dass unsere Herkunft kein unveränderbares Schicksal bedeutet, sondern wir die Chance haben, uns weiterzuentwickeln. Der genetische Bauplan steckt eher das Feld ab – in welchem Bereich wir uns niederlassen, haben wir zum Teil selbst in der Hand.
Ein Jubelschrei ging im Jahr 1897 durch die Büros von Scotland Yard. Kriminelle sollten es von nun an viel schwerer haben. Die Ermittler hatten zum ersten Mal einen Verbrecher anhand seines Fingerabdrucks überführt. Die individuelle Ausprägung von Linien und Formen macht ihn zu einem unverwechselbaren Merkmal eines Menschen, das nicht zweimal vorkommt. Selbst eineiige Zwillinge haben unterschiedliche Fingerabdrücke.
Wir sind also verschieden
Seit einigen Jahren existiert die Bezeichnung des digitalen Fingerabdrucks. Damit sind unsere Spuren gemeint, die wir beim Surfen im Internet hinterlassen. Das individuelle Muster von Klicks, wie häufig wir bestimmte Seiten ansteuern und welche Dinge wir online einkaufen, wird zu einem begehrten Instrument im Marketing. Unternehmen geben viel Geld dafür aus, um unsere Individualität zu verstehen. Komplizierte Logarithmen versuchen unsere künftigen Bedürfnisse zu berechnen, noch bevor sie uns selbst bewusst werden, und präsentieren Werbeanzeigen, die perfekt auf uns zugeschnitten sind. Individualisierung ist das Schlüsselwort.
Unser Leben ist einzigartig
Auch im Alltag erleben wir an vielen Stellen Individualisierungen. Wenn früher ein Telefon klingelte, dann gab es ein typisches Telefongeräusch von sich. Heute kann jeder in seinem Smartphone entscheiden, ob ein Pfeifen erklingen soll oder der aktuelle Hit von Lady Gaga. Wem die vorinstallierten Klingeltöne nicht ausreichen, kann sich zusätzliche herunterladen. Und Melodien lassen sich bestimmten Personen aus dem internen Telefonbuch zuordnen. So weiß man direkt, ob es sich lohnt, zum Handy im Raum nebenan zu rennen oder es klingeln zu lassen.
Auch die Veränderungen des Fernsehkonsums verdeutlichen die Macht der Individualisierung. In den 80er-Jahren gab es nur wenige Programme, die Auswahl war begrenzt. Wenn alle paar Wochen Thomas Gottschalk „Wetten, dass …?“ moderierte, versammelte sich die ganze Familie vor dem Fernseher. Für jeden war etwas dabei. Für die jungen Leute sang Michael Jackson, für die älteren Rudi Carrell. Wenn einem nicht alles gefiel, nahm man das hin und wartete auf den nächsten Act.
Inzwischen ist die Toleranzbereitschaft gesunken. Gewonnen haben Spartensendungen und -sender, wo jeder alles nach seinem Geschmack findet, wo man keine Kompromisse eingehen muss: der Musiksender, der Frauensender, der Shoppingsender, der Nachrichtensender und noch weitere gefühlt 1000 Sender, die man inzwischen empfangen kann. Rund um die Uhr bekommt man geboten, was – laut Marktforschung – zur eigenen Individualität passt. Niemand muss mehr warten, bis etwas gezeigt wird, was einem gefällt. Wir sind zu Programmchefs geworden, die dank Mediatheken, Netflix, amazon prime, spotify, mp3-Playern und vielen anderen Möglichkeiten ein eigenes Fernseh- und Radioprogramm für uns ganz allein entwickeln und es losgelöst von festen Zeiten konsumieren können. Damit haben wir aber auch viel Verantwortung bekommen, denn wenn wir uns langweilen, sind wir selbst daran schuld. Wenn wir uns nicht gut unterhalten fühlen, haben wir eine falsche Auswahl getroffen. Und wenn wir etwas Falsches konsumieren, existiert irgendwo das Richtige, das wir aber verpasst haben. Dafür gibt es inzwischen sogar eine Bezeichnung: FOMO – fear of missing out.
Verpassen ist das vielleicht größte Problem bei der Individualisierung, denn immer könnte es etwas Besseres geben, das uns durch die Lappen geht. Und nicht nur etwas Besseres, auch jemand Besseres. Der Preis der Individualität ist das ständige Vergleichen. In einem Meer aus potenziellen Partnern die wahre Liebe zu finden wird auf der einen Seite wahrscheinlicher, weil mit mehr Auswahl auch eher jemand dabei sein müsste, der zu einem passt. Doch für viele bleibt die bange Frage, ob man denn richtig gewählt hat, ob man sich nicht ganz knapp vergriffen hat. Braucht man vielleicht ein Update in der Beziehung? Müsste es denn unter den ganzen Beziehungswilligen nicht auch jemanden gegeben haben, der genauso toll ist, wie die Person für die man sich entschieden hat, nur mit dem winzigen Unterschied, dass der- oder diejenige nicht diese eine nervtötende Macke hätte?
Beziehungen gehen selten kaputt, weil man nicht zusammenpasst, sondern eher weil man davon ausgeht, dass es jemanden gibt, der noch besser zur eigenen Individualität passen könnte. Oder weil man innerhalb einer Beziehung Teile seiner Individualität einzubüßen droht. Kompromisse werden häufig als Anzeichen dafür gesehen, dass etwas falsch läuft, als Ausbremsen der eigenen Selbstverwirklichung. Dass uns eine große Auswahl keineswegs glücklicher macht, zeigt ein simples Experiment mit Marmeladengläsern. Probanden hatten die Chance, entweder aus einer kleinen oder einer großen Anzahl von verschiedenen Sorten ein Glas für sich zu wählen. Danach wurden sie gefragt, wie zufrieden sie mit ihrer Entscheidung sind. Zufriedener waren die Leute, die weniger Auswahl hatten. Vielleicht verwundert das im ersten Augenblick, da uns Vielfalt im Supermarkt immer als etwas Positives suggeriert wird. Der Mensch fragt sich dann aber, ob er sich nicht lieber anders entscheiden hätte sollen. Hätte eine andere Marmeladensorte meinen Geschmack besser getroffen? Sehen Sie eine Parallele bei diesem Experiment zur Partnerwahl?
Individualität und Familie
Kinder sind heutzutage planbar, man muss sich nicht von der Natur überraschen lassen. Zwischen zwei Meetings kann man entscheiden, Nachwuchs zu bekommen, und setzt die Pille ab bzw. verzichtet auf Kondome. In neun Monaten ist das eine wichtige Projekt im Job sowieso abgeschlossen, sodass es ein guter Zeitpunkt wäre, um mal kurz auszusteigen. Pünktlich zur Hochsaison wäre man dann wieder dabei.
Waren Kinder in früheren Zeiten Arbeitskräfte und eine Absicherung fürs Alter, nehmen sie heute eher die Rolle eines emotionalen Beziehungspartners und Sinnstifters ein. Unbewusst werden sie teilweise zur Verlängerung des eigenen Ichs, als Erweiterung der eigenen Biografie angesehen. Dabei sind die Erwartungen an sie zweigeteilt: Einerseits sind sie Teil der eigenen Selbstverwirklichung, andererseits sollen sie von klein auf ihr eigenes Selbst finden. Es wird viel Zeit und Geld investiert, um die Individualität zu fördern. Der Wandel wird am deutlichsten im Umgang: Aus einer Erziehung wurde zunehmend eine Beziehung. Sollten Kinder über Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende gehorsam sein, förderte die antiautoritäre Erziehung ab den 70er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts ihre Individualität und Eigenständigkeit. Sei einzig, nicht artig! Kinder wurden gehört und gesehen, nicht nur im familiären Umfeld, sondern auch von der Marktforschung und von Unternehmen. Ihre Individualität und ihre individuellen Vorlieben beflügeln ganze Wirtschaftszweige, angefangen von Nahrungsmitteln über Spielzeug und Kleidung bis hin zu Bildungs- und Medienangeboten.
Unsere Identität ist ein Konstrukt
Es gibt mehrere Kanäle, aus denen wir unser Selbstbild speisen. Das sind die Puzzleteile, aus denen wir uns unsere Identität zusammenbauen.
Da wir Menschen soziale Wesen sind, spielen auch andere bei diesem Prozess eine Rolle. Sie sind wie ein Spiegel für uns. Wie sie auf uns reagieren und wie sie uns beurteilen, hat einen Einfluss auf unser eigenes Bild. Wer viel positives Feedback bekommt, wird sich selbst anders erleben als jemand, der gemobbt wird. Und natürlich machen wir uns Gedanken über uns selbst. Hier vermischen sich reale Erlebnisse, subjektive Einschätzungen und das Wissen um die eigenen Interessen, Leidenschaften und Talente.
Eine dritte und ebenfalls wichtige Quelle für unser Selbstbild ist das Erzählen. Ständig reden wir über uns. Auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen, wir entwickeln dabei meist einen roten Faden. Damit erschaffen wir uns eine Identität, die uns passend erscheint. Menschen haben das Bedürfnis, dass ihr Leben kongruent ist, also keine großen Lücken und Pannen aufweist. Das führt dazu, dass wir uns rückblickend häufig falsch erinnern. So kann jemand den Eindruck haben, dass er schon immer ein Fan von Großstädten war, obwohl er eigentlich lange davon geträumt hat, auf einem Dorf zu leben. Durch das Erzählen bügeln wir unser Ich glatt. Sind wir mal gefeuert worden, werden wir das Jahre später höchstwahrscheinlich als eine lehrreiche Erfahrung empfinden. Sie hat uns dahin geführt, wo wir inzwischen stehen. Sie war eine Herausforderung, an der wir wachsen und zu der Person werden konnten, die wir heute sind. Die damalige Irritation, die Sorgen und Ängste, die damit verknüpft waren, werden rückblickend eher ausgeblendet.
Es ist daher fast unmöglich, die Frage zu beantworten, wer und wie man eigentlich ist, was also unsere Individualität ausmacht. Die Antwort ist immer eingefärbt von den Menschen aus unserer Umgebung, dem zeitlichen Abstand von existenziellen Erlebnissen und natürlich auch einer Subjektivität. In der Psychologie wird der letzte Aspekt als selbstwertdienliche Verzerrung bezeichnet. Um weiter in den Spiegel gucken zu können, sind wir oftmals nicht schonungslos ehrlich uns selbst gegenüber. Im Laufe der Evolution hat sich eine leichte Überschätzung seiner selbst sogar als sinnvoll erwiesen, da man dadurch Dinge eher wagt.
Inzwischen gibt es einen weiteren Faktor, nämlich die Selbstinszenierung in sozialen Medien. Facebook oder Instagram stellen dabei einen Scheinwerfer auf der Bühne des Lebens dar, mit dem wir auf die Aspekte leuchten, die wir zeigen wollen, die wir für gut, besonders oder interessant befinden. Niemals zeigen wir uns dort ganz, sondern nur ausschnitthaft und wollen damit – bewusst oder unbewusst – ein Bild erzeugen, für das es letztlich Applaus in Form von Likes gibt. Wir setzen uns in Szene bzw. inszenieren etwas, das wir als uns verkaufen. Wir betreiben Marketing für uns selbst, als wären wir eine kleine Werbeagentur. Die künstlerische Freiheit ist bekanntlich groß, sodass wir uns regelrecht neu erfinden und online das Leben haben können, von dem wir träumen, ganz nach dem Motto von Pipi Langstrumpf: „Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt.“
Die Suche und Entwicklung der eigenen Individualität ist immer auch ein Vergleichen. Das Vergleichen wird uns in der globalisierten und digitalisierten Welt leicht gemacht. Das Leben von Facebook-Freunden oder Promis wird zu einer Messlatte, die anspornen kann, aber genauso auch runterziehen kann. Ständiges Vergleichen wirkt zumeist wie ein schwarzes Loch, das alle positive Materie verschlingt. Studien zeigen zum Beispiel, dass Frauen nach dem Lesen von Frauenmagazinen unzufriedener sind. Eigentlich ist das keine große Überraschung, wenn man bedenkt, welche Rolle Photoshop in solchen Magazinen spielt und wie viele neue Diäten erfunden werden, die alle schreien: Du bist nicht okay, so wie du bist.
Die Möglichkeiten der Individualisierung haben also auch Schattenseiten. Dazu gehört die sogenannte ‚Filterblase‘. Sie wurde in den letzten Jahren ein Synonym für eine gesteuerte Individualisierung. In sozialen Netzwerken und auch bei google bekommen wir auf uns zugeschnittene Inhalte angezeigt. Unser Ich mit all seinen Interessen, Wünschen, Ängsten, Vorstellungen und Vorurteilen etc. wird uns damit immer wieder gespiegelt. Jeder lebt so in seiner eigenen Realität. Dass die Kommunikation zwischen Individuen dadurch – vor allem bei polarisierenden Themen – immer kompromissloser wird, ist online in den Kommentaren zu beobachten.
Die Erwartungen an einen selbst sind riesig. Man ist sich selbst der schärfste Kritiker. In Zeiten, wo man alles aus sich machen kann, entsteht schnell der Eindruck, es sei falsch, nicht nach den Sternen zu greifen. Chancen dürfe man schließlich nicht verstreichen lassen. Freizeit gilt als einer der wichtigsten Faktoren für Selbstentfaltung, aber auch die Arbeit. Sie ist häufig nicht mehr in erster Linie Broterwerb, sondern Ausdruck des eigenen Wesens.
Die Jagd nach Optionen ist eine riesige Quelle für Stress und Frustration. Wer nach allem greift, verliert vieles aus dem Blick, büßt die Tiefe ein und fühlt sich leicht wie ein Getriebener. Auch dadurch kann sich eine Identitätskrise einstellen. Vorschnell wird Individualität mit Unabhängigkeit gleichgesetzt, mit der Freiheit von (jeglichen) Bindungen. Ist man aber gänzlich bindungslos, gehört man nirgendwo hin, fühlt man sich nirgendwo zugehörig. Erneut stellt sich dann die Frage: Wer bin ich eigentlich?
Psychoanalytiker sehen in der starken Ich-Orientierung, der Überbetonung von Selbstverwirklichung den Ausdruck eines tief sitzenden Abhängigkeits- und Ohnmachtserlebens. Der Drang nach Selbstverwirklichung ist für sie eine Anpassungsreaktion auf den unbewussten Versuch, nicht wahrhaben zu wollen, welche Anforderungen die Gesellschaft an uns stellt. Dazu gehören: funktionieren zu müssen, Leistung erbringen zu müssen und erfolgreich zu sein, keine Schwächen zeigen zu dürfen, keine Niederlagen zu haben, sondern sich gut verkaufen zu können und rüberzukommen.
Eine stärkere Individualisierung bedeutet damit, einen stärkeren Fokus auf sich selbst zu haben. Unweigerlich verliert man dadurch andere Menschen in der Umgebung aus dem Blick, was zu mehr Konflikten und einer zusätzlichen Vereinsamung führen kann. Sind wir aber nicht eigentlich am schönsten, wenn wir niemandem gefallen wollen?
Wir sind besonders
Nur wenigen Menschen wird die Ehre zuteil, dass man für sie ein Denkmal aufstellt. Und so manches Denkmal wurde schon nach wenigen Jahren wieder eingeschmolzen oder abgebaut. Wenn Sie das nächste Mal in Frankfurt am Main oder in Kassel sind, können Sie selbst etwas zu Ihrer Unsterblichkeit beitragen. Im Frankfurter Grüngürtel bzw. am Brüder-Grimm-Platz steht jeweils ein Sockel, der darauf wartet, bestiegen zu werden. Das sogenannte Ich-Denkmal ist eine Skulptur des Künstlers Hans Traxler. An der Rückseite des Sockels sind Stufen, die dazu auffordern, selbst zum Denkmal zu werden. Auf der Schautafel steht: Jeder Mensch ist einzigartig. Das gilt natürlich auch für alle Tiere. Halten Sie es fest für immer. Hier. Besteigen Sie diesen Sockel, halten Sie einen Moment inne und denken Sie darüber nach, wer Sie eigentlich sind. Was ist an Ihnen besonders? Wieso sollte man Ihnen ein Denkmal errichten? Vielleicht kommen Sie Ihrer Individualität am ehesten auf die Spur. Zusätzlich können Sie ein Foto dieser Szene machen und es in den sozialen Netzwerken einstellen. Seien Sie gespannt, wie Ihre Freunde und Follower darauf reagieren.
Ach: Und falls es Sie in absehbarer Zeit nicht nach Frankfurt oder Kassel verschlägt, tut es zur Not auch ein Stuhl zu Hause.
Fazit
Die Freiheiten, die wir in der westlichen Welt haben, sind das Ergebnis vieler historischer und gesellschaftlicher Entwicklungen. Keineswegs sind sie nun selbstverständlich, sie müssen geschützt und verteidigt werden. Und vielleicht fallen Ihnen noch weitere Freiheiten ein, die wünschenswert wären.
Wir können uns glücklich schätzen, dass das Individuum heute so viele Möglichkeiten hat. Damit eröffnen sich unzählige Chancen, das eigene Leben zu gestalten und zu dem Menschen zu werden, der man sein möchte. Wir können uns selbst tatsächlich erkennen und kennenlernen, so wie es über dem Eingang zum Orakel von Delphi stand.
Freiheit bedeutet aber nicht nur, sich für etwas entscheiden zu können, sondern auch gegen etwas, selbst wenn es verlockend erscheint. Gerade in Zeiten eines Überangebots, eines unübersichtlichen Meers aus potenziellen Gelegenheiten, Lebens-(abschnitts-)Partnern, Urlaubszielen, Jobs, Projekten, Freizeitaktivitäten etc. ist es wichtig, sich nicht verrückt machen zu lassen.
Ein Lernfeld der Menschen im 21. Jahrhundert könnte darin bestehen, entscheiden zu lernen und damit leben zu lernen. Die Herausforderung ist, sich selbst genug zu sein und das wertzuschätzen, was man (erreicht) hat und wie man ist. Es ist völlig in Ordnung, einfach mal zu sein, statt immer werden zu müssen. Jeder von uns ist sowieso ein Unikat und damit ohnehin etwas Besonderes.
Über den Autor:
René Träder ist selbständiger Psychologe (M.Sc.) & Journalist aus Berlin. Als Journalist arbeitet er vor allem seit rund 15 Jahren als Radiomoderator. Als Psychologe begleitet er Veränderungsprozesse von Unternehmen, Teams und Einzelpersonen in Form von Workshops und Coachings. Zu seinen Hauptthemen zählen Kreativitäts- & Innovationsförderung, Change-management & Fehlerkultur, Kommunikation & Konflikte sowie Stimm- & Präsentationstraining. www.renetraeder.de