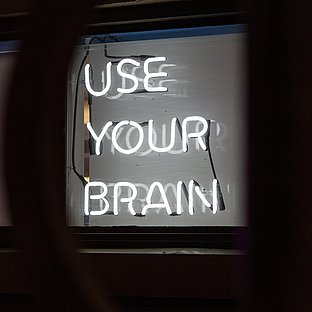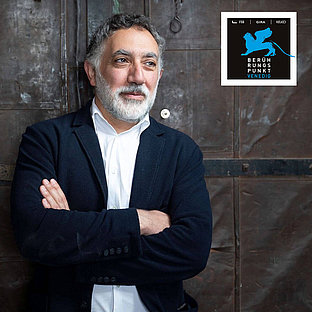Von der Kunst, Wasser zu malen – ein Besuch im Atelier von Friedel Anderson
7 min LesezeitBerührungsPUNKTE zu Besuch im Atelier von Friedel Anderson
In Itzehoe wohnt und arbeitet Friedel Anderson, Jahrgang 1954. Der Künstler bleibt – altmodisch, eigentlich – dem Realismus treu. Er malt gern und oft: Wasser. Und er kann dabei Untiefen ebenso wie Oberflächen erfassen.
Wie alles begann: Das Bild im Museum und im Katalog
An der Museumswand hängt „Kein Land in Sicht“. Ein etwa zwei Meter breiter, atemberaubender Blick auf ein Stück Wasser, offenbar von einer Fähre aus: Das Meer, grau-gischtig wie die Nordsee, wellig und bewegt, umspielt vom ersten Dunkelrot der aufgehenden Sonne – es wirkt, als sei das Wasserspiel mit einer Filmkamera eingefangen. Aber: es ist ein Bild. Genauer gesagt: ein Gemälde. Nähert man sich mit den Augen auf Handrückenlänge, erkennt man – eindeutig – Pinselstriche, die für sich genommen beliebig nebeneinander liegen und ebenso gut einen Haufen Laub oder den Bauch eines Schweins darstellen könnten – auf zwei Meter Entfernung dagegen gibt es keinen Zweifel: da glucksen die Wellen wie im Film.
Malerei erschafft Wunder, wenn sie gut ist. Dann, wenige Wochen später, sieht man dasselbe „Kein Land in Sicht“ im Katalog und erlebt einen mittelschweren Schock: Verlag und Künstler wählten zwar ein weiches, schön anzufassendes Papier, das allerdings offenbar alle Magie der bewegten Wellen in den handschmeichelnden Zellulosefasern fortgesogen hat – kein Wellenschlag, nicht mal das leiseste Plätschern ist übrig geblieben. Liegt es an der Druckerfarbe? Oder an der Verkleinerung zum Postkartenformat? Enttäuscht klappe ich das Buch zu. Ist Wasser nur auf der Leinwand so einzufangen? Nimmt auch hochglänzendes Papier, zum Beispiel auch dieses, das Sie gerade in den Händen halten, der Malerei den sinnlichen Reiz? Ich beschließe, den Maler selbst danach zu fragen.
Ankunft Itzehoe: Der Maler mag nichts erklären
Schüchtern, fast scheu begrüßt mich Friedel Anderson auf dem Bahnhof Itzehoe und heißt mich willkommen. Wir fahren eine gesichtslose Straße entlang, dann auf einer Buckelpiste durch das Gelände eines ehemaligen Zementwerks. Abrisscharme, Graffiti und eingeworfene Fensterscheiben überall. Hier hatte Anderson früher sein Atelier, mit zunehmender Verwüstung des verlassenen Geländes wurde das zu unsicher, jetzt ist er umgezogen in ein kleines Haus, das ehemals auch zum Zementwerk gehörte, direkt am Fluss Stör, einem durch die Gezeiten bestimmten Nebenfluss der Elbe. Zuhause gibt es Kaffee aus blau-getöpferten Bechern, einen Blick ins Grüne und auf einen Stapel Holz. Kuchen.
Die Werkschau zu seinem 50. Geburtstag im Kloster Cismar und im Schloss Cappenberg hat Friedel Anderson gerührt: „Die Arbeiten alle so nebeneinander zu sehen, hat mir auch gezeigt, dass wirklich alles wert ist, abgemalt zu werden. Alles.“ Die Landschaft ebenso wie der Akt, die Plenarsitzung ebenso wie eine Zuckerdose. Lübeck von oben oder nur ein Grasbüschel. Eine ganze Fischmarktszene oder nur ein Fuß. Aber erklären mag er nichts zu seinen Bildern. Wenn schon – wie häufig in der aktuell „angesagten“ Kunst soviel erklärt werden müsse, zeige sich ja schon, dass die Rezeption eher über den Kopf funktioniert – und alles Bauchgefühl verschwunden sei. Was gibt es auch zu erklären an Bildern von einem Stück Meer oder von einem Stück Hang im Schnee, aus dem ein paar angetaute Grasbüschel herausragen?
Erzählen von früher: Die gute alte Schule
Friedel Anderson malte schon immer, erst nur für sich, dann suchte er den Austausch und kam auf der Gesamthochschule Kassel an seinen Lehrmeister Manfred Bluth, der zusammen mit Johannes Grützke und anderen 1973 die „Schule der Neuen Prächtigkeit“ ins Leben gerufen hatte – ein flammendes Plädoyer für die gegenständliche Malerei, in die Kunstwelt geschleudert just zu einer Zeit, als ein Joseph Beuys voranstürmte, um das akademische Kunstverständnis für mehrere Jahrzehnte und grundlegend zu ändern. Das Manifest der Schule der Neuen Prächtigkeit, unterzeichnet von Bluth, Grützke, Köppel und Ziegler, schimpfte über „karierte Malerei“, „haltlose Architektur“ und über das „verantwortungslose Nähen ohne Abschlussknoten“ und begab sich auf die Suche nach Wahrhaftigkeit und Ursprünglichem: „Die Neue Prächtigkeit ist Arbeit; forscht nur mit Anteilnahme und ihr werdet auch in der Kargheit Prächtigkeit entdecken.
Prächtigkeit wird nur aus gesteigerter Empfindung geboren. Die Neue Prächtigkeit ist die Prächtigkeit der Gedanken und Ideen. Beobachtet mit uns die Unregelmäßigkeit von Wegrändern, wo Donnerwurz und Wegerich gedeihen oder kerzenbeschienene Kiefernstämme. (…) Nennt eure Söhne nicht Herkules und lasst sie in der Schule der Neuen Prächtigkeit die Pünktlichkeit, den eisernen Fleiß, die philosophische Pause, die Demut und das nimmermüde Naturstudium erlernen. (…) Verprächtigt das Europacenter und baut es in Gurkenform wieder auf. Legt Lindenhaine an und errichtet in ihnen Aussichtstürme, in denen Tangoorchester zum Sonnenuntergang spielen.“
„Auch in der Kargheit Prächtigkeit entdecken“
Dieses Manifest hatte mit Respekt vor der Natur zu tun, womit auch die menschliche gemeint ist. Und es hatte mit Liebe zu tun. Vielfach preisgekrönt und beinahe schon eine Art deutscher godfather of realism ist Johannes Grützke, der mitunter auch etwas hart klang: „Ein Maler, der es ernst meint, nennt sich Maler, und was er macht, ist Malerei.“ Keine Widerrede, möchte man hinzufügen. Und vielleicht lag in der aufmüpfigen Abkehr der Beuys-Anhänger von der gegenständlichen Kunst ja auch die Auflehnung gegen diese gewisse Strenge. An den bundesdeutschen Hochschulen jedenfalls, meint Friedel Anderson, werde gegenständliche Malerei praktisch gar nicht mehr gelehrt, vielleicht im Osten noch etwas mehr als im Westen. Unfassbar für einen, der diesem Handwerkszeug so große Bedeutung beimisst. Anderson unterrichtete selbst an einer Fachhochschule und ist der Meinung, dass die jungen Leute das Handwerk durchaus wieder lernen wollen.
Bei seinem Lehrer Manfred Bluth jedenfalls studierte Anderson die gegenständliche Malerei und das bedeutete vor allem die Plein-air-Malerei – die Malerei unter freiem Himmel, mit der Staffelei im Wind oder in der brütenden Sonne. Die hohe Schule der gegenständlichen Kunst komme wie Ebbe und Flut immer mal wieder, erzählt Anderson. Immer gäbe es Phasen, wo sie auf einmal entdeckt und gefeiert würde, in der Antike ebenso wie im Fotorealismus der 70er Jahre. Doch genauso verschwinde dieses Phänomen wieder, um dann erst später wieder aufzutauchen. Im Moment gilt die gegenständliche Malerei nicht viel. In Zeiten, in denen Abstraktes modern ist, gerät Gegenständliches per se unter den Verdacht des Kitsches. Es sei schon soweit gekommen, schimpfte Manfred Bluth früher, dass man den Drang bekäme, einem Maler, der mit seiner Staffelei draußen sitze, ein paar Cent zuzustecken. Der Vorteil, den Anderson sieht: Wenn jemand ein Bild von ihm kauft, dann weil es ihm wirklich ganz und gar gefällt.
Die Realität ist immer das, was man sehen will
Die Realität ist immer das, was man sehen will Friedel Anderson malt, was er vor, oder besser, was er in sich sieht. Es sind seine eigenen Interpretationen der Realität, die er in die Sprache des Bildes übersetzt. Manchmal kommen Freunde, sagt er, und wollen ihn zu einer bestimmten Stelle im Moor schicken, da falle gerade ein so großartiges Licht auf die Bäume. Der Maler muss „das Bild“ aber in sich selbst sehen, so wie ein Betrachter eines Gemäldes entweder diesen gleichen Zaubermoment nachempfinden kann – oder eben nicht.
Realismus ist ein ehrlicher Kampf, die Wirklichkeit so zu erfassen, dass der Betrachter in das Dargestellte hineingezogen wird. Friedel Anderson gelingt das immer wieder. Manches blendet in seinen Bildern, manches erscheint im Gegenlicht. In Norddeutschland ist Friedel Anderson, der sich dem Kunstbetrieb nie angepasst hat, sondern auf seine Art sperrig geblieben ist, zu einem der wichtigsten Freilichtmaler geworden. Was ihn ärgert, ist die Arroganz des Kulturbetriebs, der immer nur einen einzigen Hype feiern kann. Es sollten ja alle machen, was sie wollten, aber es müsse doch auch Verschiedenes nebeneinander existieren dürfen. Abstraktes neben Realistischem. Da stutzt der Maler, wenn auf einmal eine große bundesdeutsche Kunstzeitung nach Jahrzehnten des Wegguckens titele: „Es wird wieder gemalt!“
„Das Wasser zu malen,“ sagt Anderson, „ist immer etwas Besonderes.“ Etwas Grundlegendes. Es taucht in vielen Facetten in Andersons Werk auf. Als Meer. Mit Booten oder Schiffen. Wellen. Schnee. Wolken. Das besonders Schwierige am Wassermalen: Man kann den Moment, also genau diesen Wellenüberschlag, niemals wieder so ansehen, wie man ihn eben sah. Man muss ihn im Gedächtnis behalten und versuchen, nachzuarbeiten. Eine ganze Reihe von Bildern malte Anderson unter dem Titel „Wasser/Licht“, fast ausschließlich reine „Seestücke“, in denen man Wasser sieht und sonst nichts. Bilder, die die Tiefe des Ozeans ausmessen. Was ihn am Wasser, am Meer so reizt? Anderson, der gern mal mit Worten geizt, redet plötzlich ohne Punkt und Komma: „Im Wind auf Sylt, fast ein Sturm, da habe ich auf einmal angefangen, ganz viele kleine Skizzen zu malen vom Meer, eine nach der anderen, der Kopf hatte komplett ausgesetzt, irgendwann ist das dann schlagartig zu Ende und ich wache auf – etwas sehr Archaisches.“ Und so ist jedes gegenständliche Bild von nichts als dem Wasser in Wirklichkeit ein versuchter Blick in die Tiefe der Natur an sich – also in die Seele des Ganzen.
Über Flensburg
Friedel Anderson steht als Pleinarist fast täglich mit der Staffelei irgendwo im Freien. Dort kommen naturgemäß auch mal andere Menschen vorbei:
„Malen Sie hier?“ Eine passende Antwort will mir nicht so recht einfallen, ich murmele ein „Guten Tag“. „Ja, sie malen, jetzt sieht man es, aber warum rot, Wasser ist doch blau, und da unten die Grasfläche grün!“ „Ich bin gerade erst angefangen, und…“ Es unterbricht mich. „Kann man gar nicht erkennen. Dahinten sind doch Segelboote, und da – die Kollundfähre läuft gerade ein – sehen Sie das weiße Schiff da links, ganz klein, das haben Sie gar nicht mitgemalt!“ „Ich bin gerade erst…“ „Und da – ein Gaffelsegler! Sie malen doch wohl nicht die hässlichen Schuppen da unten? Soll alles bald abgerissen werden – wird auch Zeit.“ Die Stimme nähert sich der Dachkante ganz bedenklich.
„Jetzt nehmen Sie Gelb? Ach so – das da unten. Also – ich könnte das ja nicht. Meine Tante malt auch, malen Sie schon lange? Das machen Sie doch nicht zum ersten Mal?“ „…“ „Ein schönes Hobby! Da – die Fähre, jetzt kommt sie an dem grünen Dampfer vorbei. Na – können Sie das so schnell? Gleich ist sie weg!“ Die Stimme trennen noch 100 cm vom Abgrund. Der Wind hat aufgefrischt, von Südwest ziehen Wolken auf. Ich will sagen „Vorsicht!“, aber es unterbricht mich wieder. „Kann man denn davon leben?“ Leben – das letzte Wort klingt eigenartig lange nach. „Na dann, noch frohes Schaffen.“ Eine jähe Böe beendet den Spuk. Ich werfe einen Blick über den Rand. Unten kriecht ein einzelnes Fahrrad, die Yachtmasten an der Hafenkante schwanken wie ein Heer aus weißen Zahnstochern. Dann regnet es und ich zurre die Staffelei fester.
Gekürzte Fassung des Textes „Über Flensburg“ von Friedel Anderson (aus dem Katalog „Wirklichkeit im Gegenlicht“, Edition Braus)