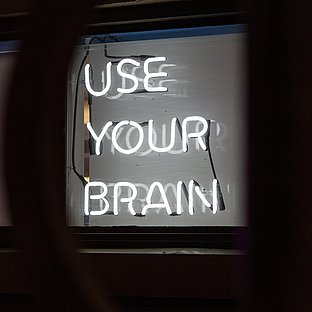(Mein) Freiraum – Peter Reischer
12 min LesezeitEin Leitartikel ist etwas sehr Persönliches, meiner journalistischen Auffassung nach drückt er eine persönliche Meinung des Verfassers aus – oder kann dies zumindest. Das bedeutet auch, die Verantwortung für den Inhalt zu übernehmen. Einen Leitartikel zum Thema „Freiraum“ zu schreiben (und dabei völlig freie Hand zu haben) ist eine doppelte Herausforderung, denn die Verantwortung für die Verwendung des Wörtchens „frei“ (und aller Wortschöpfungen, die damit zusammenhängen) ist sehr groß. Sehr schnell kann architektonischer Freiraum im Zwangsraum, Freiheit in Gefangenschaft und freies Denken in Schemata und Stereotypen enden.
Angesichts der in den Magazinen en masse kursierenden Hochglanzfotos eine Jubelhymne über Freiraum oder die Freiheit in der Architektur und die unzähligen Möglichkeiten, die uns heute (scheinbar) offenstehen, zu schreiben – das wäre verlockend und vielleicht sogar berechtigt. Bilder von Stahl-, Holz-, Beton- und anderen Palästen, von Skyscrapern und parametrischen Wunderwerken gibt es genug. Beachtenswerte Freiraumgestaltungen finden wir unter den Oeuvres mancher Architekturschaffenden auch. Im Hinblick auf die Errungenschaften unserer Zivilisation im Allgemeinen auf den dadurch gewonnenen Freiraum des Menschen, auf demokratische Verhältnisse eine Laudatio zu verfassen wäre angesichts der Weltlage allerdings verfehlt. Nach einer Studie der FAO sagt der World Food Report, dass die Weltlandwirtschaft heute problemlos das Doppelte der Weltbevölkerung ernähren könnte.
Wieso stirbt dann alle 5 Sekunden ein Kind unter zehn Jahren auf dieser Welt den Hungertod? Das sind 17.000 Menschen täglich. Jean Ziegler hat das sehr wortgewaltig und deutlich ausgedrückt: „Ein Kind, das an Hunger stirbt, wird ermordet!“ Diese Aussage war unter anderem ein Grund, dass er seine Rede zur Eröffnung der Salzburger Festspiele 2011 nicht halten durfte. Zu viele im Publikum hätten sich betroffen fühlen müssen, und kein Mensch, der gerade in der Oper sitzt, möchte sich bei diesem Satz als Mörder fühlen.
So wäre es andererseits ein Leichtes, eine apokalyptische oder dystopische Zukunft zu malen und schreibend zu projizieren. Täglich wird weltweit die Fläche mehrerer Tausend Flug- (pardon) Fußballfelder Natur zubetoniert. Oft werden die darauf entstandenen Architekturen nicht einmal zeitgerecht eröffnet und überholen sich selbst im Lauf der Zeit. Landmarks entstehen und vergehen, Menschen verhungern neben vollen Töpfen, Obdachlose betteln vor den Schaufenstern der Luxus-Einkaufstempel der Superreichen, die Sinnsuche ergibt keinen Sinn mehr, die „Westler“ suchen ihr Heil im Osten in der Wiedergeburt, während der Osten dem Kreis des Wiedergeborenwerdens verzweifelt entkommen will. Vertauschen sich da etwa die Rollen oder Positionen?
Ich – und damit bin ich bei meinem eigenen Freiraum angelangt – will trotz aller negativen Prognosen von Wissenschaft und Zukunftsforschern und trotz allem Bewusstsein über den Ernst der Lage versuchen, keinen düsteren Artikel zu verfassen. Zu groß ist mein Glaube an das Gute im Menschen, an das Evolutionäre, an den Sieg der Vernunft über das Reptiliengehirn. Alles, was kluge und denkende Menschen wie Ziegler oder Ugo Bardi äußern (Bardi ist ein langjähriges Mitglied des Club of Rome, sein Buch „Der Seneca-Effekt“ befasst sich mit dem Kollaps weltweiter Systeme. Hier ist es der berühmt-berüchtigte einzelne Tropfen, der das Fass plötzlich zum Überlaufen bringt, ob es um zwischenmenschliche Beziehungen, politische Systeme oder ökologische Probleme wie den Klimawandel geht.), all das muss nicht zwingend als Bedrohung unseres Selbstverständnisses betrachtet werden, sondern kann auch eine Aufforderung sein.
Ein Weckruf, die Welt real zu sehen und nicht als Produkt des Wirtschaftswachstums. Ein Fußballfeld weniger zubetoniert ist kein Rückschritt, sondern ein Schritt! Ich hoffe und rechne mit dieser Vernunft, obwohl das manchmal angesichts gewisser Wahlergebnisse (Amerika, Österreich, Deutschland und Tschechien) sehr schwer fällt. Aber auch das ist zu akzeptieren, denn es fällt unter die Rubrik „freie Willensentscheidung“ des Wählers und ist auch ein Teil des demokratischen Freiraums. Die Verantwortung, mit dieser Freiheit umzugehen, kann uns niemand abnehmen.
Wenn man die Entwicklung der Menschheit als eine spiralförmige, nach oben strebende Linie betrachtet, so wie es zum Beispiel manche französische Philosophen tun, stellt man fest, dass sich diese Spirale – ab einem gewissen Punkt – in eine Gerade verwandelt hat und ins Nichts zu gehen droht. Hat man bei einer Wanderung den Weg verloren, ist in die Irre gegangen, so ist die Frage der Umkehr eine wesentliche. Das In-die-Irre-gehen ist gleichzusetzen mit einer Krise, und diese gibt es in der Geschichte der Menschheit in periodischen Abständen wiederkehrend. Und in der Krise verliert sich der Blick auf den Sinn und auch auf das Ziel. Doch umkehren oder sich rückbesinnen heißt in diesem Fall immer, zurückzugehen bis zu dem Punkt, an dem man den richtigen Weg verlassen hat. Diesen Punkt zu finden, das scheint mir heute das große Problem zu sein. Es gibt viele Denkrichtungen, die sich mit dem „Rück-“, „Wieder-“ oder „Re-“ stark befassen. Auch in der Architektur sind derartige Tendenzen zu bemerken. Immer weniger Büros befassen sich mit reinem Neubau, sie stecken eine Menge Know-how in die Umnutzung und Neubearbeitung alter Bausubstanzen. Bauen im Bestand ist absolut „in“!
Die großen Worte, die -ismen und Satzkonstruktionen der Architekturtheorie bis zur und über die Postmoderne sind fad und tausend Mal gesagt. Ich schlage vor, sich über die bekannten Theoretiker wie Charles Jencks, Robert Venturi, Heinrich Klotz und Co. hinwegzusetzen und sich dem Denkmodell von Sir Karl Popper zuzuwenden. Hinwegsetzen heißt in seinem Denken nicht nicht-beachten, sondern einen kritischen Standpunkt einnehmen. Denn Popper geht von der prinzipiellen Fehlbarkeit des Wissens und der Wissenschaft aus. Als Gegenmodell zu einer „geschlossenen Gesellschaft” (von Platon, Hegel, Marx, denen er totalitäre Züge vorwarf) entwarf er eine „offene Gesellschaft”, die nicht am Reißbrett geplant wird, sondern sich pluralistisch in einem fortwährenden Prozess von Verbesserungsversuchen und Irrtumskorrekturen evolutionär fortentwickeln sollte. Auf die Architektur übertragen, sehe ich darin etwas Lebendes, sich Bewegendes, das dem Menschen dient. Und das kann man bereits immer häufiger in den Denkansätzen mancher Architekten entdecken.
Viele Planer haben ein unbestimmtes, schummriges Gefühl, dass trotz aller Bildmächtigkeit und allem Perfektionismus etwas mit der immensen Bautätigkeit nicht stimmt: Schräg stellen, krumm machen, grün anmalen – das sind Lösungen, die zwar manche Verblüffung auslösen, aber niemals den Menschen im Mittelpunkt haben. Wenn die Architektur sich von ihrer ursprünglichen Funktion des „Behausens“ und „Schutz für Menschen“ zu schaffen von der Spirale zur Geraden wegentwickelt hat, könnte man ihr eine Art Borderline-Syndrom attestieren: Verzweifelt einem ständigen Vorwärts, einer Maximierung der Bilder nachlaufend, weiß sie genau, dass sie auf dem falschen Weg ist. Sie unterliegt jedoch einer innerlichen Zerrissenheit, und diese Spannung führt zu immer weiteren Auswüchsen. Oder ist es die Empfindung der Vergänglichkeit dessen, was sie für eine kleine Ewigkeit zu erbauen erachtet? Warum sind eigentlich Begriffe wie Gott, Glaube, Liebe, Hoffnung und Poesie in der Architektur stigmatisiert und tabu?
Natürlich möchte ich hier auch die kommende Architektur-Biennale in Venedig streifen. Zeichnet sich bei der Themenwahl der Biennale über die letzten Jahre mit „Common Ground“, „Reporting from the Front“ und nun mit „Freespace“ eine klare Linie ab? Von der Show der Egomanen (2014) über den Underground (2016) zur Frauenpower (2018)? Der Begriff soll bitte nicht falsch verstanden und auf keinen Fall absichtlich falsch interpretiert werden (honni soit qui mal y pense!). Ich schätze die beiden Architektinnen Yvonne Farrell und Shelley McNamara als sehr bewusste und verantwortungsvolle Menschen ein. Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass die beiden diesjährigen Kuratorinnen vor allem durch ihre Bildungs- und Schulbauten bekannt sind. Denn in der Bildung, in der Erziehung liegt die Chance, dass in Zukunft weniger Fußballfelder weltweit zubetoniert werden. Und Frauen tragen nun mal einen wesentlichen Teil zur Bildung und Entwicklung der Männerwelt bei.
2016 lehrte uns Alejandro Aravena, dass Architektur eines der Instrumente der Zivilgesellschaft ist, um den Raum, in dem diese lebt und arbeitet, zu organisieren. Farrell und McNamara werden diesmal die Perspektive der Qualität des öffentlichen und privaten Raumes, des urbanen Raumes, des Territoriums und der Landschaft als den Hauptzweck von Architektur in den Fokus stellen und präzisieren. Einige Passagen aus ihren Presseaussendungen lassen aufhorchen: So sprechen sie von einem „demokratischen Raum, unprogrammiert und für unvorgesehene Nutzungen frei“. Das kommt in die Nähe des „hodologischen Raumes“ (griech: hodos = Weg, Pfad) von Otto Friedrich Bollnow. Dieser beschreibt einen Raum, der unabhängig vom geometrischen und euklidischen Raum besteht, er wird ausschließlich durch die Bewegung, durch den Menschen erfahr- und erlebbar. Eine „lebendige Geometrie“ der „hodologischen“ Verbindung sieht ganz anders aus, als dies sich der Architekt denkt.
Ein weiteres gutes Beispiel für KEINE funktionale Vorbestimmung seitens der Architekten oder der Architektur ist die Restauration und Neuverwendung eines alten Getreidespeichers in Kombination mit einem Taubenschlag in Portugal durch Tiago do Vale Arq.tos. Der wiedererrichtete kleine Holzbau, der eine gewisse Poesie vermittelt, wird der Natur und der Zeit zur Verfügung stehen und sich den möglichen, unvorhersehbaren Nutzungen hingeben.
Auch im hochtechnologisierten Japan gibt es bereits Ansätze. Dort bauten die Schemata Architects in eine alte Lagerhalle einen Wohnraum für einen privaten Nutzer ein. Da die Halle viel zu groß war, blieb ein nicht unbedeutender Leerraum, dessen genaue Nutzung in der Zukunft niemand voraussehen kann und der auch unbestimmt bleiben soll, neben dem tatsächlich benutzten Raum übrig. Dieses Wohnen neben dieser Leere bringt Spannung, ist ein Gegensatz zum westlichen Denken der Maximierung und Ausnutzung aller Ressourcen. Hier ist Freiraum (freespace) ein Raum der Möglichkeiten, ein Geschenk an den Nutzer.
Für unsere Länder wünsche ich mir zum Beispiel eine Regelung, die Bauherren verpflichtet, pro 10 Quadratmeter zubetoniertem Boden einen Baum zu pflanzen oder 10 Quadratmeter Fassade zu begrünen. Eine (steuerliche) Regelung, die belohnt, wenn klug verschwendet statt blöd gespart wird. Ein Umdenken in der Architektur, weg vom Nützlichen und Gewinnorientierten zu einer menschlichen, auf das Humane orientierten Raumverwendung. Freie Räume gibt es genug, denn auch ungenutzte Räume sind Freiräume.
Und es gibt sie ja bereits, die hoffnungsvollen sozialen, wirtschaftlichen, ökologischen und architektonischen Alternativen: Gemeinwohlökonomie, Fair-Banking, Car-, Desk- und Roomsharing, Architekten, die „rückbauen“ statt „neu bauen“, sechsgeschossige Bürohochbauten, die ohne Heizung und Kühlung auskommen (2226 von Arch. Eberle), Urban Gardening und Urban Mining, die „neue Wildnis“ in der Freiraumgestaltung (Berlin/Tempelhof und Wien/Nordbahnhof), zivilgesellschaftliche Initiativen und die vermehrte Verwendung von Holz in der Architektur sind Beispiele eines Wandels, einer Veränderung. Baruch Spinozas Konzept „In der Natur Gott zu treffen“ wird immer öfter in Arbeiten mancher Architekten sichtbar. Seine rationalistische Technik der Entsagung kann Vorbild sein. Denn Reduktion ist ein Gewinn, kein Verlust.
Text: Peter Reischer, Journalist und Architekturkritiker