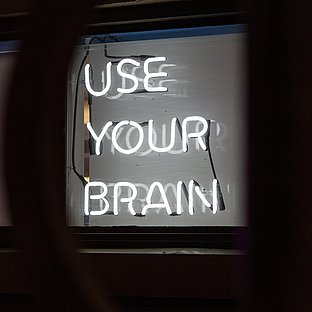Leben am Meer – ein Bericht der Journalistin Kornelia Roßkothen
4 min LesezeitViele träumen davon. Manche machen es wahr.
Zu Hause alles hinschmeißen. Eine Arbeit finden, die man an jedem Ort machen kann. Und dann endlich ans Meer ziehen. Eine, die diesen Traum wahr gemacht hat, ist die Journalistin Kornelia Roßkothen. Sie zog vor zwei Jahren von Wuppertal nach Hörnum auf Sylt. Hier ihr Bericht vom Leben an einem Ort, den jährlich Hunderttausende besuchen:
Wie oft habe ich davon geträumt beim letzten Spaziergang an den Strand, als die Koffer schon gepackt waren. Noch einmal die Füße in den Sand graben, noch einmal den Horizont mit den Augen abmessen und salzige Kühle in die Lungen ziehen, eine letzte Welle bewundern, wie sie ausläuft auf dem flachen, harten Boden. Und dann denken: Warum kann es nicht immer so sein? Wie wäre es, wenn ich das auch morgen haben könnte? Und übermorgen? Und die Woche darauf? Würde es langweilig, dieses Meer, wäre es irgendwann Alltagskulisse wie zu Hause der kleine Park um die Ecke? Und warum, zum Teufel, bleibe ich eigentlich nicht hier?
Die Schwärmerei für das Leben am Meer ist ein junges Vergnügen und eins der Privilegierten. Die Heilwirkung des Salzwassers war in der Antike zwar wohlbekannt, aber Griechen und Römer aalten sich in Badehäusern, statt sich in die Wellen zu werfen. Die Küstenorte suchte man wohl auf, aber mehr zufällig, den Handelswegen nach, und in der Sommerhitze der angenehmen Luft wegen. Danach spielte das dunkle, bewegte Wasser jahrhundertelang ausschließlich die Rolle des menschenfressenden Ungeheuers.
Wenn etwas den Menschen an den Rand des festen Landes lockte, war es die Aussicht auf Reichtum durch Handel, nicht der Wunsch nach Gesundung und Kontemplation. Das Seebad ist erst eine britische Erfindung des 18. Jahrhunderts. Die Wasserkuren des „Doctor Brighton“ Richard Russel lösten eine frische und salzhaltige Modewelle aus, die allerdings Jahrzehnte für den kurzen Weg nach Norddeutschland brauchte; an die Sylter Küste schwappte sie sogar erst 100 Jahre später. Einer ihrer Wegbereiter war das Naturbild der Romantik, ein anderer Verwandter die Sehnsucht nach Flucht aus den industrialisierten Städten. Wir haben also alle wohl noch Caspar David Friedrich im Kopf, wenn wir uns am letzten Urlaubstag hin zum Horizont träumen. Gut die Hälfte aller Menschen lebt in Küstennähe, die wenigsten von ihnen teilen diese Romantik. Dort, wo der Tourismus ein Stück Küste erobert, ist der ursprünglich nutzlose, unfruchtbare Sand oder Fels plötzlich Gold wert. Die verrückten Fremden wollen – welch ein Wahnsinn! – so nah wie möglich an der gefährlichen Wasserkante wohnen. In die Caspar-David-Friedrich-Ansicht schieben sich Bungalows und Betonburgen. „Atlantis“ war der Name eines solchen Projektes, um das zu Beginn der 70er Jahre auf Sylt erbittert gestritten wurde. Neben den 28 Etagen mit 3000 Betten hätten sich die ohnehin schon absurd wirkenden Klötze des so genannten Kurzentrums am Westerländer Strand ausgenommen wie Modellspielzeug. Damals stoppte das Land den Bauwahn. Die heutige schleswig-holsteinische Landesregierung hingegen will Wachstum. Die Diskussion um eine 600-Betten-Anlage, die im Sommer im 500-Seelen-Ort Rantum eröffnet wird, hat das Dorf entzweit – nur ein Beispiel von vielen.
Solcher Art ist der Alltag, der mich manchmal einholt, wenn ich die Füße in den Sand grabe. Meist aber siegt die anscheinend unzerstörbare Magie dieser Nahtstelle zwischen Wasser und Land und tut ihr Wunderwerk nicht nur an den Atemwegen und der Haut, sondern auch an der Seele. „Nirgendwo wird einem der Hauch des Alls (darf man dieses Gleichnis wagen?) so aufs Butterbrot geschmiert“, schrieb der Theaterkritiker Alfred Kerr. Das Butterbrot ist üppig bestrichen. Allein dieser endlose Himmel, ein Schauspiel, dessen Akte oft mehrmals täglich wechseln, das flockige Schäfchen vorbeitanzen lässt oder fedrige Cirren, das dunkelgraue Gewitterdrohung auftürmt oder am Abend das ganz große Finale in tausend Rottönen auffährt. Oder das Meer, freundlich plätschernd oder brüllend vor Wut. Manchmal gibt’s zum Butterbrot noch ein Kleckschen Kaviar extra. Wenn zum Beispiel beim Baden im Meer am frühen Abend ein Schweinswal-Pärchen neugierig ein Stückchen näher schwimmt, um sich das ungeschickte, rosa Tier in seinem Revier anzuschauen.
Ich bin hiergeblieben. Das bedeutet, dass es nicht jeden Tag die verschwenderisch mit Ewigkeit belegten Butterbrote geben kann. Ab und zu sind ein paar vertrocknete Krusten dazwischen wie der neue Bauboom. Oder der mindestens drei Stunden lange Weg ins nächste Opernhaus. Andere Dinge muss man einfach erst mal schlucken in einer Tourismusregion. Den krassen Kontrast zwischen Saison (voll und hektisch, aber warm und hell) und Nicht-Saison (leer und ruhig, aber kalt und dunkel) zum Beispiel, auch wenn heutzutage nicht mehr im Winter die Schaufenster zugenagelt werden.
Das zuweilen etwas doppelbödige Verhältnis zu den Touristen, die hier immer schon „Gäste“ heißen und von denen zwar alle Sylter leben, aber deren massenhafte Anreise letztlich den Untergang jenes Zaubers bedeutet, dessentwegen sie doch herkommen. Ich versuche aber, jeden Tag ein Häppchen zu nehmen vom Hauch des Alls, von der anrührenden Schönheit, indem ich auf der Fahrt in die Inselhauptstadt wahrnehme, dass um mich nicht graue Vorstädte sind, sondern die herrlichsten Dünen, oder indem ich immer mal zwischendurch an den drei Minuten von meiner Wohnung entfernten Strand husche. Ich bin hiergeblieben und angekommen.