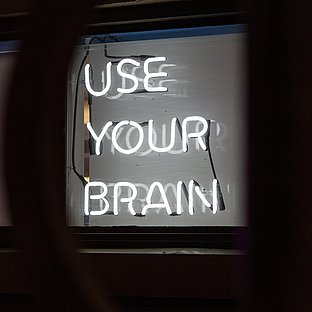Freiheit, Last und Schutz: Was Zweckentfremdung uns über den Zweck der Architektur lehrt
4 min LesezeitDenn wenn wir nähertreten, wird die Sache nicht einfacher. Gerade jetzt, da der Umbau im Bestand eine immer wichtigere Bauaufgabe wird, zeigt sich, dass sich vieles zu vielem umnutzen lässt. In den Kirchen von früher findet man heute Büros, Herbergen oder Kindermuseen, in einem Silo entsteht eine Bibliothek, Gasometer werden zu Wohnungen, Kunst lässt sich scheinbar überall unterbringen – in ehemaligen Dieselkraftwerken, Bunkern oder Ställen. Der Zweck, dem die Architektur diente, wird durch einen anderen ersetzt, nicht immer, aber immer öfter. Wenn das Zweckentfremden so normal geworden ist, scheint es ja genauso zur Architektur zu gehören wie der Zweck selbst. Und trotzdem machen sich Architekten Gedanken über die richtige Fassade, die richtige Form, die dem Zweck angemessene Erscheinung. Ein Wohnhaus ist eben doch etwas anderes als ein Industriebau. Architektur scheint also noch einem anderen Zweck zu dienen als nur dem eine Funktion zu erfüllen. Um dem auf die Spur zu kommen, wollen wir uns vier Beispiele, ein etwas älteres und drei neuere anschauen, in denen etwas zweckentfremdet wurde – das Gebäude, die Bauteile, der Typ.
Respekt und Befreiung
Erste Station: Das Heuneburgmuseum in Hundersingen an der Donau, am Nordrand Oberschwabens. Für die Funde einer keltischen Siedlung wurde 1991 eine Zehntscheuer von Johannes Manderscheid und Heinz Bienefeld zum Museum umgebaut. Doch nicht nur das. Viermal hatte das Gebäude von 1783 den Besitzer gewechselt, war verändert und umgebaut worden. Manderscheid und Bienefeld stellten die ursprüngliche Geschlossenheit des Hauses außen und die große Halle im Innern wieder her. Neu eingezogene Galerien setzen sich deutlich lesbar vom Bestand ab, ebenso wie alles andere neu Hinzugekommene so sorgfältig detailliert und gestaltet ist, dass Neu und Alt voneinander unterschieden werden kann. Das Alte wird vom Neuen ausgestellt: Man tritt ihm wie etwas Fremdem gegenüber, das zu würdigen man verlernt hat – und das nun würdevoll in seiner ursprünglichen Form wieder in Wert gesetzt wird. Der Umgang mit dem Bestand war noch kein selbstverständlicher, das Bewahren musste als eine Qualität gezeigt werden, weil es nicht ohne weiteres als solche erkannt wird. Der Unterschied zu den aktuelleren Beispielen zeigt, was sich seither geändert hat.
Zweite Station: Berlin. Im Hof eines Wohnbaus, in direkter Nachbarschaft zum Mauerstreifen, steht ein kleines Haus, das etwas merkwürdig wirkt. Wie die Bricollage eines Heimwerkers. Es wurde aus Platten eines abgerissenen Plattenbaus zusammengefügt, die Fensterelemente kommen vom Palast der Republik. Das Modellhaus, das die TU Berlin in Kooperation mit Wiewiorra Hopp Architekten entwickelte und realisierte, lässt sich erweitern, als Baukastensystem bis zu drei Geschossen auftürmen. Diese pragmatische Sicht ist die eine. Konzentriert man sich auf das Spielerische, Unprätentiöse dieses Kleinsthauses, dann lässt es sich anders lesen: Die Geschichte, die uns in Architektur und Städtebau so viele Fragen und vor so viele Probleme stellt, kann leichter angegangen werden, wenn wir uns von dem Ballast befreien, den diese Bauten durch ihre Verbindung zu einem politischen System darstellen.
Freiheit und Schutz
Dritte Station: wieder Berlin, diesmal Neukölln. Ein stattliches Pumpwerk aus den 1920er Jahren wurde in eine Galerie mit Wohn- und Arbeitsräumen verwandelt. Der große, vier Stockwerke hohe Luftraum zeichnet sich außen durch die über die ganze Höhe reichenden Fenster und markanten Pfeiler aus Ziegel ab. Die neue Nutzung lässt sich außen nicht ablesen, kein Türschild oder gar mehr verrät die Galerie. „Yuppiepack, verpisst euch aus Neukölln!“ steht nicht weit entfernt auf eine Hauswand gesprüht. Die Stimmung gegenüber denen, die dafür sorgen, dass solche Baudenkmale erhalten bleiben können, ist nicht gut. Viele Bewohner fürchten durch steigende Mieten verdrängt zu werden. Da ist es besser, sich nicht demonstrativ nach außen zu öffnen. Diese Galerie muss sich aber nicht tarnen. Nach außen bleibt alles überwiegend so wie es war. Innen aber kann der neue Nutzer diese ungewöhnlichen Räume auf eine Weise nutzen, die sich nicht mehr an dem Macht- und Gesellschaftssystem orientiert, für den dieses Gebäude einst gebaut wurde.
Vierte Station: Mulhouse, im Süden des Elsass. In einer Arbeiterwohnsiedlung aus dem 19. Jahrhundert haben mehrere bekannte Architekten mit neuen Modellen für den Sozialen Wohnungsbau experimentiert, haben die Stereotypen, die in Frankreichs Sozialen Wohnungsbau herrschen, über Bord geworfen. Eines dieser Modelle sieht eher wie ein Gewächshaus denn wie ein Wohnungsbau aus. Die Pariser Architekten Anne Lacaton und Jean-Philippe Vasall hatten diese Konstruktion aber nicht gewählt, weil sie die darin wohnenden Menschen mit Pflanzen gleichsetzen wollen, sondern weil sie ihnen als eine einfache und preisgünstige Methode erschien, den Bewohnern mehr Platz zu bieten und ihnen mehr Freiheit dabei zuzugestehen, sich ihren Raum so zu gestalten, wie sie es für sich als richtig empfinden.
Teilweise doppelt so groß als herkömmliche Sozialwohnungen sind diese Wohnungen geworden. Aber es ist auch das Bild, das frei macht: Es stellt nicht mehr den Anspruch, sich Schemata des vermeintlich richtigen Einrichtens, der Orientierung am gängigen Geschmack zu fügen. Eine Freiheit, der man freilich gewachsen sein muss – und der die Architekten offen gegenüberstehen: Sie interessieren sich auch dafür, wie die Bewohner mit ihren Häusern umgehen, anstatt sie dafür zu verurteilen, mit ihrem eigenen Geschmack der Architektur vermeintliches Unrecht anzutun.
Ziehen wir Bilanz: Vier Beispiele umgenutzter Häuser, umgenutzten Materials und zweckentfremdeter Typen haben uns gezeigt, dass die Architektur den Bestand erst zu einem Bild machen musste, das wir als Qualität sehen lernen mussten – dass sie nun aber durch die Bilder, die sie vermittelt, schützen kann, dass sie durch das Öffnen neuer Sichtweisen befreien kann. Es zeigt uns, dass sich die Bedeutungen, die wir der Architektur zumessen, mit dem Zweck ändern, dem sie dient. Dabei ist Architektur immer auch eine öffentliche Angelegenheit. Sie zwingt uns dazu unsere Bewertungssysteme zu überprüfen. Architektur ist ein gesellschaftliches Medium, mit dem über das verhandelt wird, was man als Gesellschaft, was man als Gemeinschaft in welcher Weise wichtig nehmen, was man einander zugestehen möchte. Das ist auch ein Zweck, und kein unwichtiger – seinetwegen wird unentwegt über Architektur gestritten. Und die Qualität der Architektur zeigt sich nicht zuletzt darin, wie sie diesen Zweck erfüllt. Funktional kann sie dann ja immer noch sein.