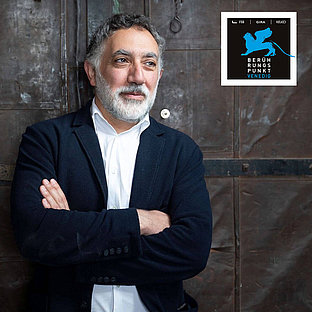Eine neue Zukunft? Eine Rezension zur Architektur-Biennale in Venedig von Peter Reischer
15 min LesezeitIn einigen Kritiken und Berichten wurde die Architektur Biennale in Venedig als Gelegenheit für Familienausflüge bezeichnet. Für jeden wurde etwas geboten, für Erwachsene, Architekten, Zuschauer und auch für Kinder. Und das trotz des schwierigen Themas, das diesmal von den beiden Kuratorinnen Yvonne Farrell und Shelley McNamara (Grafton Architects aus Dublin) mit „Freespace“ vorgegeben war. Andere Kollegen vermuteten bei den Kuratorinnen und deren Manifest zum Thema religiöse Tendenzen und sahen in den diversen Beiträgen nur das Auf- und Ausräumen (in diversen Länderpavillons). Wieder andere waren fasziniert von den zur Schau gestellten Modellen und deren handwerklicher Perfektion oder sie ergingen sich in zwar tiefschürfenden, aber theoretischen Abhandlungen über Sinn und Zweck von Freiraum. Das hat alles seine Berechtigung, wie das Motto Freespace ja suggeriert.
Das Manifest der beiden war schon lange bekannt, man hätte es jederzeit lesen können, dann wäre man vielleicht nicht so überrascht gewesen, angesichts dieser Architektur-Biennale. Es ist der Versuch, den Begriff des Freespace zu erklären. Humanistische Wertvorstellungen und große Worte sind zu finden: Von der Freigebigkeit des Geistes und dem Sinn für Menschlichkeit als Grundlage der Architektur liest man da; ein unprogrammierter freier Raum, ein demokratischer Raum soll er sein, die Möglichkeit der Gaben der Natur (Licht, Sonne, Luft etc.) nutzen und vieles mehr. Freespace ist sicherlich kein einfacher Begriff, er beinhaltet vieles und er lässt auch Raum für Interpretationen. Freespace ist jedoch – um mit den Worten von Ralf Moneo zu sprechen – nicht mit Common Space und Public Space zu verwechseln. Freespace geht weit darüber hinaus. „Free Space“ könnte man auch als Art eines kategorischen Imperativs deuten.
„Freespace feiert die Fähigkeit der Architektur, in jedem Projekt eine zusätzliche und unerwartete Großzügigkeit zu entdecken“, formulierten die Kuratorinnen recht vieldeutig und blumig. Aber diese Gabe, dieses Geschenk der Schöpfung muss man auch wahrnehmen können, und so entpuppt sich diese Biennale – je weiter (zeitlich) man von ihrem unmittelbaren Erleben entfernt ist – als eine Aufforderung zur Reduktion, zur Selbstbescheidung, und man kann zu Recht feststellen, dass die Architektur endgültig im postheroischen Zeitalter angekommen ist. Die Zeit der Stararchitekten und der hochglanztauglichen Bilder ist endgültig vorbei. Auch Sean Griffiths (Professor, Architekt an mehreren internationalen Architekturuniversitäten) hat das schon formuliert. Er stellt die Zukunft des Architektenberufs, so wie er heute abläuft, überhaupt infrage und meint, dass man für die scheußlichen kastenförmigen Rasterwohn- und sonstigen -bauten eigentlich keine Architekten mehr braucht. Die Funktion des Architekten kann doch nicht auf die Farbgebung von Markisen und die Auswahl von Türgriffen beschränkt sein. Das Fortdenken der Hypothese von Griffiths kann in verschiedene Szenarien führen: in eine dystopische Welt, in der Maschinen die Bauten (für den Menschen) errichten, oder zu einer Architektur, die aus und in der Natur wie von selbst entsteht.
IM ARSENALE
Wenn man sich nun zwischen Selfies machenden JapanerInnen und weiße Hüte samt schwarzen Hutbändern tragenden, schwarz behemdeten Architekten bis zum Eingang in die 317 Meter lange Cordiere (die ursprüngliche Seilmacherei der venezianischen Schiffswerften) vorgekämpft hatte, wurde man entweder von einem Handystick getroffen oder von der geballten Kraft des ersten Bildes berührt: Ein Vorhang aus Hanfseilen bildet den Eingang und erinnert an den ursprünglichen Sinn dieses Raumes. Er befreit ihn von gewohnten Sehweisen und macht neugierig auf das Kommende. Dieser Vorhang – als Zitat der ursprünglichen Funktion – entzieht der Halle ihre seit Jahren eingeschriebene Funktion als Ausstellungsraum und bringt sie an ihren Ursprung zurück. Im Dunkel des nächsten Raumes, gleich dahinter, werden Grundrisse, Schnitte, Schiffszeichnungen, Konstruktionspläne weiß überblendend an die Wände projiziert, sie erinnern an Zeit, Kultur, Verlust und Erfolg und das „Vergehen“ der Dinge. An dieser Installation müssten oder sollten sich alle weiteren Projekte und Darstellungen eigentlich eine Richtschnur nehmen, denn hier tritt der Faktor „Zeit“ in Erscheinung. Und mit Zeit ist auch der Raum des Entstehens gemeint, der (lange) Weg von der Idee zur Realisation einer Architektur. Und Architektur kann nicht nur ein oder das Resultat sein, sie ist auch immer ein sozialer Prozess.
Die Kuratorinnen haben keinerlei Einbauten oder Trennungen in der langen, dreischiffigen Halle vorgenommen. In den beiden Seitenschiffen ist Platz für 65 Einzelpräsentationen. Optische Täuschungen mit Raumspielen, Projektionen und Leerräume sind hier zu finden, auch ein bewusst als Leerraum konzipierter kreisförmiger, „digitaler“ Freespace mit Sitz- und Liegeflächen. Aber auch großartige Projekte, die Architektur auf den Boden der Wirklichkeit bringen. Es wurde generell wieder von allen Teilnehmern sehr viel Wert auf Design und Gestaltung gelegt, nicht wie vor 2 Jahren, wo auch improvisiert werden durfte. Die Modelle – meist aus Holz oder anderen „sustainablen“ Baustoffen – waren von einer hervorragenden handwerklichen Qualität. Die ganze Biennale duftete nach Pinienharz, geräuchertem Bambus, Lehm, Erde und Natur. Scheinbar hat Peter Zumthor mit seiner Aussage (der Rückkehr des Handwerks) von vor zwei Jahren doch recht behalten. Andere Teilnehmer wiederum erschöpften sich in Theorie, Wände vollgepickt mit Notizen, Philosophie und Konstrukten. Das ist auch OK, denn die Grafton Architects haben ausdrücklich von „built and unbuilt“ gesprochen.
Hinter der Cordiere, bei den Länderausstellungen, gab es noch einige optisch aufregende Momente, bis sich diese nach der ersten Verblüffung über die Wirkung der Bilder als (reine) Show entpuppten: Eine scheinbar endlose Struktur in einem runden, horizontlosen weißen Raum mit Tonkulisse war irritierend und regte zum Taumeln an, bogenförmig abgehängte Papierbahnen mit einem schmalen Durchgangsspalt, Wasserspiele und Rauchkulissen, Videoprojektionen usw. In den hier gezeigten architektonischen Projekten blieb meist der (Zeit)Raum zwischen der Theorie und der Materialisierung, der Raum der Produktion und der Prozess – den Aravena vor zwei Jahren angerissen/begonnen hatte – unbearbeitet und ausgespart. Oder wird die Schaffung von Architektur bereits wirklich von Maschinen erledigt, wie es der Parametrismus, Drohnen und 3D-Druck vorgeben?
DIE GIARDINI UND WEITER
Ganz im Geist der Reduktion ist der Hauptpavillon auf den Giardini gestaltet. Viele Einbauten und Zusatzräume hat man entfernt, dabei auch einige architektonische Schätze (Fenster von Carlo Scarpa) wiederentdeckt. Wenn hier nun einige der Teilnehmer den Erwartungen nicht ganz entsprechen, liegt das an der Theorielastigkeit und auch an der Unbeschreibbarkeit von Freespace. Wände voller Skizzen, Fotos und Diagrammen sind nicht für jeden verständlich. Oft wird ein Wissen vorausgesetzt, das – wenn nicht vorhanden – den Betrachter ratlos zurücklässt. Aber die Anregung, den Blick auch woanders hin zu lenken (auf den Fußboden von Assemble zum Beispiel) ist auch dem Thema geschuldet und hilft darüber hinweg.
Dieses „Unbefriedigende“, das manche Besucher verspürt haben, mag aber teilweise auch an der postmodernen Art und Weise, in der wir eine Biennale „lesen“, liegen. Die verschiedensten Schichten und Erzählweisen existieren in dieser Wahrnehmung parallel und gleichzeitig und das Format einer Biennale ist scheinbar nicht mehr geeignet, um all diese Rezeptionsmöglichkeiten und Erwartungen darzustellen oder zu erfüllen. Und so ließen sich hier auch musterhaft weiterführende Arbeiten (Sanierung eines Pavillons einer psychiatrischen Klinik in Belgien von de vylder vinck taillieu architecten) entdecken.
Auch die Politik kommt hier nicht zu kurz: Proteste gegen verfehlte Stadtpolitik und mangelnden Wohnraum vor den Toren der Biennale, und im deutschen Beitrag durften sich die Politikerin Marianne Birthler und das Architekturbüro Graft Gedanken über das räumliche Zusammenwachsen nach dem Mauerfall in Berlin machen. Verschiedene Stelen bilden (jedoch nur aus einem speziellen Sichtwinkel) eine Wand und auf deren Rückseiten findet dann das „unbuilding“ in realen oder angedachten Projekten statt.
Aber auch das Poetische, die Magie konnte man in Venedig entdecken. Abseits des großen Rummels schuf der Vatikan auf der Insel San Giorgio Maggiore bei seinem ersten Auftreten auf der Biennale einen Ort der Stille und der Besinnung. Und hier zeigte sich, dass die sogenannten Stars auch anders können. 10 (welt)berühmte Architekten durften je eine Kapelle in einem verwunschenen Park realisieren und dabei einen anderen Blick auf baubare Realität zeigen. Diese Orte der Stille sind ein Beispiel des Freespace, wie sie aber nur mit einem entsprechenden geistigen, um nicht zu sagen spirituellen Hintergrund machbar sind.
Der Preis der Biennale, der Goldene Löwe für den besten Länderpavillon auf den Giardini ging diesmal an die Schweiz. Sie hatte sich als eine der wenigen Länder, einen der vor der Biennale genannten Schwerpunkte – den Wohnbau – aufgergriffen und dabei auch versucht, den Freespace wenigstens zu streifen. Und zwar mit dem typischen „Schweizer Humor“. Die Kuratoren, vier wissenschaftliche Mitarbeiter der ETH Zürich, bauten in den Pavillon eine „leere“ Wohnung ein. Leer ist nicht ganz richtig, die Räume sind zwar leer, aber mit allen zum Wohnen notwendigen Strukturen wie Türen, Fenstern, Einbaukästen, Beschlägen, Steckdosen und Schaltern ausgestattet. Ein Parkettboden mit weißen Sockelleisten, weiße Wände und Decken ziehen sich durch die verwinkelten Raumanordnungen – das ist aber auch schon alles.
Aber nun verwischen sich die Maßstäbe: Türklinken in 1,80 Meter Höhe inklusive einer 2,40 Meter hohen Tür, winzige Fenster in 1,60 Meter hohen Räumen, auch die Elektroinstallationen sind Sonderanfertigungen und dem verrückten Maßstab der einzelnen Zimmer angepasst. Links von der Eingangstür schrumpft alles auf Zwergengröße zusammen, rechts werden die Elemente immer größer, bis sie den maximalen Stand von 2,40 Meter erreichen. Dementsprechend ist auch der Titel „Svizzera 240: House Tour“ zu verstehen. Vielleicht ist der Beitrag aber auch eine versteckte Kritik am von Grafton Architects gewählten Titel Freespace.
SCHLUSSWORT
Jetzt, Monate nach der Eröffnung, werden Fragen immer deutlicher, Fragen, welche die Zukunft der Architektur, aber auch die Ausbildung zukünftiger Architekten betreffen. Was geben wir der kommenden Generation von jungen Architekturschaffenden mit? Was wird deren Vorbild sein? Die Nichtnotwendigkeit von Prestigebauten für Konzerne oder Museen, die Unsinnigkeit von Megaprojekten für Industrie und Städtebau ist offensichtlich. Zu sehr werden solche Architekturen von finanziellen, politischen, technischen und Effizienzkriterien bestimmt. Es ist der vielleicht größte Verdienst des diesjährigen Events und seiner Kuratorinnen, den fast unabdingbaren Kreislauf und Wettbewerb um die Steigerung, um das Übertreffen des schon Dagewesenen durchbrochen zu haben.
Vor zwei Jahren – Alejandro Avarena – was kommt danach? Kann man die konzeptuelle Revolution, die er angestoßen hat (Reporting from the Front), noch toppen? Tut das überhaupt not, oder ist ein bescheidener Beitrag auch zu akzeptieren? Das zwangsläufig Neue ist nicht immer auch das Bessere, und so beschränkten sich Farell und McNamara auf eine „leise“ Biennale voller Gedanken und voller Freiräume, die man allerdings selbst und für sich entdecken konnte und musste. Die Grafton Architects haben bewusst den Fokus auf unspektakuläre Projekte gelegt. Sie haben auch darauf verzichtet, Eigenes nach Venedig zu transportieren – ein Ausdruck einer neuen Bescheidenheit? „Wir sind Architekten und keine Kuratoren!“ – ein Satz, der nachdenklich stimmt.